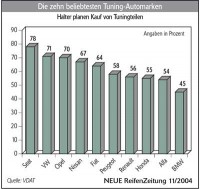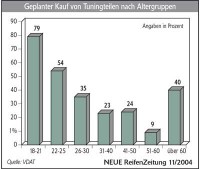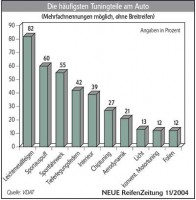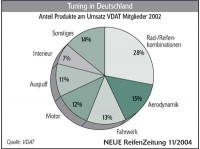Rallye „Dakar“: BFGoodrich will sechsten Titel holen
Bei der 27. Ausgabe des Rallye-Raid-Klassikers „Dakar“ (vom 1. bis zum 16.
Januar 2005) geht BFGoodrich wieder an den Start: als Reifenpartner der Werksteams von Volkswagen, Mitsubishi und Nissan. Nach den fünf Siegen in den vergangenen fünf Jahren will man im kommenden Jahr nun das halbe Dutzend an Titeln voll machen. Die Teams können bei der insgesamt 8.
956 Kilometer langen und 16 Tage dauernden Reise von Barcelona bis nach Dakar auf drei verschiedene Reifentypen in 16-Zoll-Dimension zugreifen. Der „Baja T/A Rock“ soll sich beispielsweise als Allrounder vor allem für sandige Untergründe und felsige Pisten eignen, während der etwas weichere „Baja T/A Sand“ dank eines angepassten Profils als erste Wahl für ausschließlich sandige Passagen gilt. Laut BFGoodrich rüsten fast alle Topteams ihre Fahrzeuge mit Systemen zur Justierung des Reifenfülldrucks während der Fahrt aus.
So lässt sich zum Beispiel für extrem sandige Passagen der Innendruck auf bis zu 1,2 bar absenken. Dies erhöht die Reifenaufstandsfläche um bis zu 50 Prozent und beugt so dem Steckenbleiben vor – birgt zugleich aber auch die Gefahr, dass die Pneus durch Überhitzung strukturelle Beschädigungen davontragen. Auf felsigem Untergrund schützt ein Druck von bis zu 3,0 bar vor Verletzungen der Reifenflanken.